Ich bin seit Samstag Abend wieder in Bangui und habe Internet.
Es scheint, dass das Coronavirus noch nicht in Mobaye angekommen ist. Aber genau weiß das natürlich niemand. Eine Testmöglichkeit gibt es vor Ort nicht, im Verdachtsfall wird eine Probe entnommen und per Flugzeug nach Bangui geschickt.
Seit dem Monat März galten in der Zentralafrikanischen Republik eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie: Distanz halten, kein Händeschütteln, Schulen geschlossen, Bars und Kneipen geschlossen, keine öffentlichen Gottesdienste, keine großen Menschenansammlungen, deren Teilnehmerzahl die 15 übersteigt. Die Märkte und unzähligen Straßenläden blieben dagegen weiter geöffnet… Wer schon einmal die Gelegenheit gehabt hat, ein Land im subsaharen Afrika zu erleben, wird sofort die Stirn runzeln und sich sagen: „Wie soll denn das funktionieren??“ – Und das ist genau das, was die Menschen mir hier ständig sagten: „Bei euch in Europa mag das ja gehen, bei uns aber nicht!!“
Die katholische Kirche, der Verbund der Evangelischen Kirchen und der muslimische Dachverband hatten sich Ende März mit dem Präsidenten des Landes darauf verständigt, keine öffentlichen Gottesdienste in Kirchen und Moscheen zu feiern. Allerdings waren es nur wir, die Katholiken, die sich an die Abmachung hielten, auch bei uns in Mobaye. Die Protestanten waren davon überzeugt, dass man jetzt erst recht viel und laut und in großen Massen beten müsse, nur so ließe sich der Virus fern halten. Die Muslime meinten, dass ein Verbot öffentlicher Gebetsversammlungen eh nichts bringe: wenn Gott beschlossen hat, dass Du am Virus stirbst, werden daran die Schutzmaßnahmen nichts ändern. Wenn Gott beschlossen hat, dass Du am Virus nicht stirbst, dann kannst Du Dich so oft Du willst in großen Menschenansammlungen treffen.
So einfach ist das.
Als Katholiken standen wir mit unserer Option, der Regierung zu folgen, ziemlich schlecht da, auch und gerade bei unseren eigenen Leuten. Wir feierten jeden Sonntag zwei Gottesdienste parallel, den einen in der Kapelle der Schwestern, den anderen in der großen Kirche. Dabei versuchten wir die Teilnehmerzahl von 15 nicht zu überschreiten. Das hatte zur Folge, dass etliche Leute draußen vor der Kapelle der Schwestern hockten, und andere sich dann doch in unser großes Gotteshaus schleichen. Aber der Großteil blieb verärgert zu Hause oder ging zu den Protestanten, die eifrig weiterfeiern. Und im Viertel mussten sich unsere Leute anhören, wie kleingläubig Katholiken sind: Die kleinste Ankündigung einer Krankheit, und sie verriegeln die Kirchentüren…
Seit Pfingsten jedoch haben sich die Vorschriften geändert. Unter Wahrung der Abstandsregel und Hygienemaßnahmen sowie Maskenpflicht dürfen wir nun wieder öffentlich Gottesdienste feiern (wobei so gut wie niemand auch wirklich eine Maske aufsetzt und einen Meter Abstand zu seinem Nachbarn hält).
Auch wir im Bistum Alindao (Caritas und Codis) organisieren Aufklärung zu Covid 19
Aber nicht nur die Vorschriften, sondern auch die Zahlen der Neuinfektionen haben sich geändert. Während die Zentralafrikanische Republik in den Monaten März und April bis Mitte Mai nur vereinzelte Fälle zählte, schnellte die Zahl der Infizierten und Erkrankten seit Mitte Mai sprunghaft in die Höhe, wenn auch nicht in europäischen oder amerikanischen Dimensionen (4000 Infektionen, knapp 40 Tote). Gleichzeitig entschied man sich, die ohnehin kaum respektierten Schutzmaßnahmen zu lockern. Irgendwie scheint man mehr auf die Entwicklung im Westen zu schauen als auf die im eigenen Land…
Eines jedoch bleibt geschlossen: die Schulen. Seit Wochen heißt es, die Abschlussklassen sollten bald wieder die Schulbank drücken, um das Jahr nicht zu verlieren… Aber bislang geschieht nichts. Rebellion und Corona haben eine ganze Generation von Schulkindern in endlose „Ferien“ geschickt.
Und zu all dem zeichnet sich eine weitere Herausforderung am Horizont ab, die der ganzen Corona-Krise noch einen politischen Aspekt verleiht: Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Dezember. Aber das ist ein anderes Thema, für einen späteren Zeitpunkt.
Ach so, fast hätte ich es im aufkochenden Corona- und Wahlkampfrausch ganz vergessen: Die Rebellen haben wir auch noch. Und sie werden immer dann aktiv, wenn es gerade nicht passt.
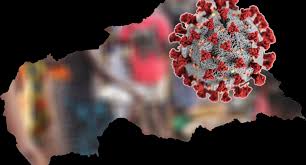









 Schon auf dem Weg in unser Krankenhaus haben wir mit den Eltern gesprochen, Ihnen von Dr. Onimus und seinen chirurgischen Missionen erzählt. Allerdings müsste das Kind noch wachsen; im Alter von zwei Jahren könnte man an eine Operation denken.
Schon auf dem Weg in unser Krankenhaus haben wir mit den Eltern gesprochen, Ihnen von Dr. Onimus und seinen chirurgischen Missionen erzählt. Allerdings müsste das Kind noch wachsen; im Alter von zwei Jahren könnte man an eine Operation denken.

 Brigitte Peerenboom wollte drei Monate ihres Sabbatjahres mit uns verbringen. Viel Zeit hat sie uns geschenkt, Gesangsstunden in der Grundschule und Gitarrenunterricht auf unserer Veranda für eine große Anzahl von Jugendlichen, Mithelfen bei den alltäglichen Kleinigkeiten, die anfallen, auch mal das Auto fahren. Mitleben, Mitbeten, Mitarbeiten.
Brigitte Peerenboom wollte drei Monate ihres Sabbatjahres mit uns verbringen. Viel Zeit hat sie uns geschenkt, Gesangsstunden in der Grundschule und Gitarrenunterricht auf unserer Veranda für eine große Anzahl von Jugendlichen, Mithelfen bei den alltäglichen Kleinigkeiten, die anfallen, auch mal das Auto fahren. Mitleben, Mitbeten, Mitarbeiten. Es handele sich dabei um zumeist Männer, die einen Pakt mit dem Bösen eingegangen seien. Nachts hielte sie nichts mehr im Haus, eine unwiderstehliche innere Kraft treibe sie hinaus an das Ufer. Dort angekommen entledigen sie sich ihrer Kleidung, werfen sich ins Wasser, drehen sich mehrfach um ihre eigene Achse und werden somit zu Nilpferden. Kurze Zeit später machen sie sich auf die Suche nach einem ahnungslosen Opfer.
Es handele sich dabei um zumeist Männer, die einen Pakt mit dem Bösen eingegangen seien. Nachts hielte sie nichts mehr im Haus, eine unwiderstehliche innere Kraft treibe sie hinaus an das Ufer. Dort angekommen entledigen sie sich ihrer Kleidung, werfen sich ins Wasser, drehen sich mehrfach um ihre eigene Achse und werden somit zu Nilpferden. Kurze Zeit später machen sie sich auf die Suche nach einem ahnungslosen Opfer.





